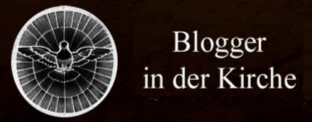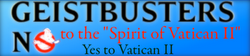Da sucht man wochen-, fast monatelang die Antwort auf eine Frage, und dann bekommt man sie mal so eben nebenbei — während einer halben Stunde Anbetung und in Form eines knapp fünf Jahre alten Gebets meines Bistums, mit dem ich damals nicht viel anfangen konnte (kam mir zu platt, zu eng, zu betulich vor). Gepaart mit einem sehr guten Gespräch kurz danach, das in einer guten Stunde mehr Sinn erbracht hat als die letzten anderthalb Jahre davor, hat diese halbe Stunde Anbetung viele Folgen des Kampfes/Krampfes überwunden und mich darüber hinaus noch auf ein wunderbares Lied im Erfurter Anhang gestoßen. Wow!
Archives
All posts by Vincentius Lerinensis
Vor einem Monat beglückte mich Christ in der Gegemwart mit einem als Umfrage getarnten Werbeschreiben, nun hat die Herder-Korrespondenz nachgezogen. Obwohl es bei CiG um „Kirche wohin?“ ging, bei der Herder-Korrespondenz aber um „Deutschland vor dem Papstbesuch“, unterscheiden sich die Themenfelder der Umfragen nicht sonderlich: beide drehen sich eigentlich um den Dialogprozeß und den Rest des gegenwärtigen kirchenpolitischen Tagesgespräches.
Soweit, so gut, nur zertrümmern mir die Umfragen mein Weltbild. Während ich das Probeabo von CiG wegen regelmäßiger Herzattacken fast nicht überlebt hätte, war die Herder-Korrespondenz zwar nicht immer in voller Länge interessant, aber sie hatte immerhin ein differenzierteres Niveau als CiG und war durchaus wissenschaftlich zitierbar (was zum Teil der Grund für die Langeweile gewesen sein dürfte :-). Wenn ich nun aber die Umfragen vergleiche, dann ist die der CiG aber um Längen differenzierter. Schon alleine die Antwortvorgaben: Während bei CiG Mehrfachauswahl möglich war und verschiedene Aspekte eines Themenfeldes berücksichtigt wurden, gibt es bei der Herder-Korrespondenz immer nur die gleichen Antworten, von denen man sich für eine entscheiden muß: „Ja“ und „Nein“.
Leider kann man bei keiner Frage mit dem Ankreuzen einer dieser Vorgaben die Frage angemessen beantworten, was nicht zuletzt daran liegt, daß die Fragen schonmal gleich gar nicht angemessen gestellt sind. Etwa Frage 3: „Die Bischöfe haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt.“ Könnte man ja ankreuzen, könnte man aber auch nein ankreuzen, je nachdem, welche Bischöfe man vor Augen hat und worin man den „‚Ernst der Lage“ sieht (ich vermute, ich sehe den „Ernst der Lage“ in einer anderen Richtung als die Umfrageersteller). Oder Frage 6: „Das kirchliche Leben wird mehrheitlich von Frauen getragen, die katholische Kirche aber von Männern geleitet: Daran muß sich etwas ändern.“ — Ja: die Männer sollten sich mehr ins kirchliche Leben einbringen. Nein: an der Leitung durch Priester kann sich nichts ändern. Ganz zu schweigen von Frage 10: „Der Papstbesuch wird die Stimmungslage im deutschen Katholizismus deutlich verbessern.“ Mal davon abgesehen, daß ich beim Begriff „Katholizismus“ jedesmal zusammenzucke (rein begrifflich: katholisch läßt sich nicht „ismisieren“, denn dann ist es nicht mehr allumfassend; historisch: ganz bestimmte Ausprägung katholischen Lebens, die schon seit dem einen oder anderen Jahrzehnt vorbei ist, auch wenn das ZdK immer noch die Ordnung des frühen 20. Jahrhunderts repräsentiert), ist natürlich die Frage, was man unter „deutschem Katholizismus“ versteht. Die Doppelnamen-Gutmenschenfraktion wird sich jedenfalls nicht vom Papst die schlechte Stimmung verderben lassen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Herder-Korrespondenz hat es mit einem einzigen Werbeschreiben geschafft, mein bisher positives Gesamtbild der Zeitschrift von Grund auf zu zerstören. Herzlichen Glückwunsch, das ist doch mal eine Leistung.
Um den Gedanken von gestern weiterzuführen: Im Grunde habe ich durchaus Verständnis für die Suche nach (weitschaftlicher) Sicherheit, denn von hause aus bin ich genau so veranlagt (und es war ein langer Weg vom Wunsch der Verbeamtung wegzukommen :-). Eine solche Suche hat auch nicht zwangsläufig was mit Materialismus oder egoistischen Habenwollen zu tun. Wenn ich nicht weiß, wie ich den heutigen Tag überleben soll, ist es nicht so ganz einfach, sich ganz dem Gottesreich zu widmen. Solche Schwierigkeiten sind in unseren Breiten aber nicht unbedingt der Normalfall (anderswo schon, siehe Ostafrika).
Auch habe ich Verständnis dafür, daß jemand Panikattacken bekommt, wenn er seine Stelle zu verlieren droht, auf deren Existenz er seine Existenz aufgebaut hat. Wo ich aber verständnislos davor stehe, ist die Angst, in einigen Jahren die Stelle möglicherweise verlieren zu können. Ich frage mich, wie man überhaupt erstmal ruhigen Gewissens sich dermaßen von einer bestimmten Einkommenshöhe abhängig machen kann. Ok, wenn die Stelle eine wäre, bei der man sowieso noch aufstocken muß und trotzdem immer am Rande des Untergangs steht, wäre das noch nachvollziehbar. Aber wenn es sich um eine sehr gut bezahlte Akademikerstelle handelt, die Kinder schon lange aus dem Gröbsten raus sind und in der Familie noch ein zweites Einkommen existiert, verstehe ich nicht, woher eine solche Existenzangst kommen kann, daß man für die Erhaltung der noch gar nicht bedrohten Stelle auch über Leichen zu gehen bereit ist. Daß man dabei noch nicht einmal merkt, wie man indirekt an dem Ast sägt, auf dem man sitzt, macht die Sache nur noch unverständlicher. Und sich gleichzeitig zu fragen, was eigentlich mit „Erlösung“ heute gemeint sein könnte, schlägt dann dem Faß den Boden aus…
Da werde ich mal wieder aufgefordet, etwas nachzuweisen, was nicht existiert, nämlich eine bestimmte Form von Einkommen. Nun ist es naturgemäß etwas schwierig, Belege für nicht-existente Einkünfte vorzuweisen, aber daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Ist halt so, wenn man nicht ins 08/15-Schema der Behörden paßt.
Der kleine Unterschied ist diesmal aber: Nicht nur die Behörden erwarten, daß beide Elternteile Einkünfte (wohlgemerkt fast immer: aus nichselbständiger Erwerbsarbeit; egal wie hoch die Einkünfte aus anderen Einkunftsarten sind) haben, auch eine ganze Menge Bekannte gehen wie selbstverständlich davon aus, wenn der Vater längerfristig Elternzeit nimmt, geht natürlich die Mutter arbeiten. Unabhängig davon, ob das wirtschaftlich nötig ist oder nicht, ob ein Säugling zu stillen ist oder nicht.
Mich irritieren solche Selbstverständlichkeiten. Auch wenn wir während meiner Elternzeit zu zweit zu hause sind, ist es ja nicht so, daß wir faul auf der Haut lägen. Eine Handvoll Kinder versorgt sich ja nicht gerade von selbst oder mal eben nebenbei. Sicherlich könnte auch einer alleine den Haushalt und die Kinder managen, aber ob das den Kingern gerecht wird, wenn es an der Flexibilität fehlt, auf ihre Bedürfnisse ad hoc einzugehen.
Keiner, der weiß, wovon er redet, wird wohl bestreiten, daß Kinder und Haushalt auch ohne Bezahlung als Arbeit durchgehen. Oder doch? In der FAZ war vor einiger Zeit ein Beitrag über einen Selbstversorgerbauern, der zwar nichts über seinen Eigenbedarf hinaus produzierte, aber auch keinem anderen auf der Tasche lag. Ihm wurde (explizit in einem Leserbrief) vorgeworfen, nicht zu arbeiten, mit der Begründung, er produziere ja nichts. Arbeit scheint heute gleichbedeutend mit Erwerbsarbeit zu sein, was sogar noch hinter Marx zurückbleibt.
Arbeit kann, wenn sie sinnvoll ist, erfüllend sein — wer wollte das leugnen. Kriterium der Erfülltheit ist doch aber kaum die Gehaltszahlung. Oder doch? In der Sonntagspredigt — eine Betrachtung über das Thema „Urlaub“ — hieß es zum Einstieg, wir wären jedes Jahr aufs Neue urlaubsreif, bräuchten eine Auszeit aus dem Streß, seien überarbeitet durch die ständige Forderung, vielleicht sogar Überforderung. Und da sei es gut, eine Unterbrechung des Alltags zu haben, im Urlaub uns Gott zuzuwenden und von ihm stärken zu lassen.
Warum lassen wir sowas mit uns machen? Ich denke, das sind alles Beispiele dafür, daß das ganze Koordinatensystem nicht stimmt. Wenn ich vom Alltag gestreßt bin, ist dann keine Zeit für Gott die Folge oder vielleicht eher sogar die Ursache? Daß ich unbedingt etwas machen oder erreichen will, wozu ich nicht befähigt und berufen bin, sondern was ich mir um meines Egos willen in den Kopf gesetzt habe? Daß Produktion von Geldwert wichtiger ist als Gott?
Update: Noch ein Indiz.
Daniel Suarez: Daemon. Die Welt ist nur ein Spiel; Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2010. 622 Seiten.
Mathew Sobol, schwerreiches Computergenie und Chef einer erfolgreichen Online-Spiele-Firma, stirbt an einem Gehirntumor. Die Nachricht seines Todes löst über das Internet andere Ereignisse aus. Ein Daemon — in UNIX-Betriebssystemen ein im dauerhaft im Hintergrund laufendes Programm, das auf bestimmte Auslöser hin bestimmte Prozeduren auslöst — ist redundant im Internet verteilt und ganz offensichtlich von Sobol selbst dort plaziert worden. Die ersten Aktionen, die der Daemon nach Erfassen der Todesnachricht Sobols auslöst, sind Morde an Chefentwicklern von Sobols Unternehmen, die vermutlich zuviel von der Programmierung des Daemons wußten. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, denn während die MMORPG-unerfahrenen Cops und Feds nicht den leisesten Schimmer haben, womit sie es hier zu tun haben, wirbt der Daemon über Sobols Computerspiele Hacker, die trotz hoher Computerkenntnisse auf der Verliererseite der Gesellschaft stehen, und andere Menschen, die nichts zu verlieren, aber alles zu gewinnen haben, an, verschafft sich Geldquellen, aus denen er seine teuren „Augen“, „Ohren“ und „Hände“ in der realen Welt finanzieren kann, und beginnt, ein riesiges Unternehmen zur Umstrukturierung der Gesellschaft aufzubauen — kurz: er wird mit jeder Sekunde mächtiger.
Ich bin an das Buch mit der Erwartung herangegangen, es sei ein Cyberpunk-Roman. Am Anfang wurde diese Erwartung auch im wesentlichen bestätigt, zumindest ist der erste Teil ein Hacker-Roman, in dem mit Wissen und Können die Technik auszutricksen ist. Dieser erste, knapp das halbe Buch umfassende Teil ist spannend, in sich geschlossen und endet mit einem würdigen Abschlußsatz, der die ganze vorherige Geschichte nochmal in einem anderen Licht erscheinen läßt.
In diesem ersten Teil wird auch die Grundidee des Buches entfaltet, für die es zurecht landauf, landab gelobt wird. Denn was dort beschrieben und entwickelt wird, ist eigentlich keine Science Fiction. Zwar bezieht das Buch viele Grundmotive aus dem Cyberpunk-Genre, Teile der Grundkonstellation ähnelen sogar so stark der Neuromancer-Trilogie (genauer: Count Zero; wesentlicher Unterschied: Joseph Virek vegetiert noch vor sich hin, Mathew Sobol ist schon tot), daß ich nach 200 Seiten schon fast keine Lust mehr hatte weiterzulesen. Der wesentliche Unterschied liegt aber darin: Als William Gibson von Cyberspace und Matrix schrieb, war das Internet noch eine technisch aufwendige Idee, und was in seinen Büchern dort geschieht, war tatsächlich Science Fiction (und ist es größtenteils bis heute). Was Suarez beschreibt, ist technisch keine große Schwierigkeit, es bräuchte tatsächlich nur jemanden, der es sich leisten kann, und auch dort bleibt Suarez durchaus im Rahmen des Möglichen. Und das ist das eigentlich Erschreckende des Buches: Daß es bewußt macht, was technisch bereits Realität sein könnte, ohne daß wir es merken.
Leider konnte Suarez nicht der Versuchung widerstehen, die Geschichte weiterzuschreiben — mit je etwa halbjährigen Sprüngen schließen sich zwei weitere Teile an, in denen es immer weniger um die Technik und ums Austricksen derselben durch Hacken geht, sondern um die klassische Action-Thriller-Konstellation: Die gute Seite versucht die böse Seite aufzuhalten. Dabei fehlt es nicht nur am Hacking, das (nur) noch am Rande vorkommt, weil es sich in der Anti-Daemon-Task-Force wohl nicht ganz vermeiden läßt, sondern Daemon gipfelt in einer gigantischen Materialschlacht, in der nur noch ein einziger Clou steckt, nämlich daß sich eine der beiden Parteien als in sich gespalten entpuppt und damit eine dritte Partei zwischen Daemon und Regierung auftaucht. Daran ist aber nichts mehr „tricky“, nur noch Action.
Hinzu kommen zu viele parallele Storylines, die mitunter zu lange nicht weitergeführt werden, so daß Figuren, wie Anji Anderson und Brian Gragg, die im ersten Teil eine zentrale Rolle spielten, in den weiteren Teilen nur noch am Rande vorkommen, aber keine eigenständige Entwicklung mehr durchschreiten, und ihre Funktion für die Geschichte übernehmen andere, neu eingeführte Figuren. Man könnte dies als die Austauschbarkeit der Personen für den Daemon interpretieren, aber wenn Brian Gragg, eine der zentralen Figuren für einen Handlungsstrang des ersten Teils, am Ende plötzlich als einer der mächtigsten Agenten des Daemons auftritt, ohne daß sein Weg dorthin eine Rolle gespielt hätte, dann funktioniert diese Interpretation nicht mehr.
Auch fehlt mir die Ambivalenz sowohl der Technik als auch der Charaktere. Während bei Gibson & Co die Helden nur ein kleines bißchen weniger verrückt sind als die ihrerseits auch nicht eindeutig bösen „Schurken“ (die vielleicht einfach bloß eine kleine Dosis mehr des um sich greifenden Wahnsinns abbekommen haben), wird bei Suarez, je näher man dem Ende kommt, immer deutlicher, daß auch der Daemon selbst in ein Schwarz-Weiß-Schema gepreßt wird, das durch die Spaltung der einen Gruppe nur noch deutlicher statt ambivalent wird. Der Leser ist am Ende geradzu versucht, den verbliebenen Teil der einen Gruppe plötzlich ihrem ursprünglichen Gegner zuzuschlagen, was nicht nur an dem unumgänglichen Seitenwechsel einer Hauptfigur liegt.
Während der erste Teil also ein absoluter Brecher ist, wurde mir im zweiten und dritten Teil stellenweise sogar langweilig. Vielleicht ist meine Erwartungshaltung „Cyberpunk“ fehlerhaft gewesen (die zum Teil als Verneigungen vor dem Genre zu verstehenden Referenzen sind aber überdeutlich, etwa vor „Snow Crash“, wenn im letzten Kapitel des Buches völlig irrelevant für die Handlung Mythologie und Poetik als informatischer Code interpretiert werden). Das Augenöffnende des ersten Teils aber läßt auch den Rest des Buches flüssig lesen. Und wer nicht so sehr auf Hacking und Cyberpunk steht, wird vielleicht zum genau entgegengesetzen Urteil kommen.
Ich bin eigentlich ein großer Freund des Verkehrsmittels Bahn. In der Regel habe ich auch keine Probleme mit Verspätungen, dem Finden des günstigsten Fahrpreises und der besten Verbindung. Jetzt habe ich es aber doch noch geschafft, eine „Lücke im System“ zu finden. Was bei direkten Verbindungen kein Problem ist, scheint mit einem kurzen Zwischenstop in einer Stadt am Rande des Weges nicht mehr ohne weiteres zu funktionieren: Alle Verindungen zu finden.
Fahre ich von x nach z, finde ich Verbindungen im Stundentakt. Will ich aber von dort nach y weiterfahren und das ganze mit einer einzigen Fahrkarte machen (wir erinnern uns: normalerweise habe ich keine Probleme den günstigsten Fahrpreis zu finden, was natürlich Rund- und Rückfahrten bei mehreren Fahrtzielen innerhalb von zwei Tagen mit einschließt :-), fehlt plötzlich jede zweite Verbindung zwischen x und z — und das unabhängig davon, ob es sich um eine Direktverbindung oder eine mit Umsteigen handelt. Auch wenn „schnelle Verbindungen bevorzugen“ ausdrücklich weggeklickt und als Abfahrtszeit die des gewünschten Zuges angegeben ist, findet er diesen nicht. Erst manuelle Anpassung der Umsteigezeit („früher in z ankommen“) ließ den gewünschten Zug auftauchen — mit dem Problem, daß der gewünschte Anschluß nicht mehr auswählbar war.
Also Neustart mit der nun ermittelten Aufenthaltszeit und erneute manuelle Anpassung — und voila: Da ist die gewünschte Verbindung. Gebe ich die nun ermittelte Umsteigezeit aber von Anfang an ein, findet er diese Verbindung wieder nicht. Erst langsames Reduzieren der Umsteigezeit ergibt dann wieder die gewünschte Verbindung — nach Abzug von 10 Minuten. Aber Vorsicht: bei zuviel Abzug gibt es gleich wieder den nächsten Zug von x…
Meine Güte, wer hat das denn bloß programmiert?!
Update: Was im Internet ein Schmerz im verlängerten Rücken war, ging am Automaten völlig problemlos. Watt’n Quatsch.
Stanislaus hat auf die Antwort von Kardinal Meisner zur Frage nach einem Pontifikalamt in der forma extraodinaria hingewiesen. Stanislaus nennt das beiläufig eine „negative Antwort“. Bei genauerer Betrachtung ist es aber keine negative Antwort, weil sie überhaupt keine Antwort auf die gestellte Frage beinhaltet.
Die Frage lautete kurz und knapp:
können Sie sich vorstellen, ein Pontifikalamt in der außerordentlichen Form des römischen Ritus zu feiern?
Wenn ja, warum?
Wenn nein, warum nicht?
Es gab bei „direktzu Kardinal Meisner“ mehrere Fragen zur außerordentlichen Form, und ich vermute, daß ich nicht der einzige war, der gerade diese Frage gerade wegen ihrer Formulierung unterstützt hat. Sie bot die Möglichkeit, mal ernsthafte Argumente zu bringen (sei es für oder wider). Und dann sagt er nicht einmal, ob er sich das vorstellen könnte, wenn es denn mal einen Anlaß gäbe, sondern nur, daß er zur Zeit keinen Anlaß sieht:
Zu Ihrer eigentlichen Frage:
Bisher habe ich kein Pontifikalamt in der außerordentlichen Form gefeiert. Obwohl ich 1962 zum Priester geweiht worden bin und die Messzelebration anfangs noch in der außerordentlichen Form praktiziert habe, müsste ich mich heute intensiv darauf vorbereiten. Augenblicklich sehe ich keinen Anlass, selbst ein Pontifikalamt in der außerordentlichen Form zu feiern.
Ok, sich darauf intensiv vorbereiten zu müssen, ist ein valides Argument gegen ein Pontifikalamt in der außerordentlichen Form am, sagen wir mal: kommenden Sonntag. Vermutlich ist die Planung eines Erzbischofs von Köln aber sowieso längerfristiger als bis kommenden Sonntag. Daß er im Augenblick keinen Anlaß sieht, ein solches zu feiern, sagt ja noch nichts darüber aus, was wäre, wenn ein solcher Anlaß gegeben wäre (spinnen wir mal rum: etwa anläßlich der Wiederherstellung der vollen Gemeinschaft mit der Piusbruderschaft?). So kann man natürlich eine negative Antwort da reinlesen — aber sie steht da nicht. Das ist eine Interpretation, die der Rezipient vornimmt, und der wird immer seine eigenen Erwartungen in so einen Text reinbringen, sei es, daß ein deutscher Bischof eh nie außerordentliche zelebrieren wird (sei es aus Feigheit, sei es aus Überzeugung), sei es, daß Kardinal Meisner ja gerne würde, sich aber bisher eben kein Anlaß ergab, was man ja durch eine Anfrage ändern könnte, oder der Widerstand aus $FEINDBILD-Kreisen zu groß ist.
Toll, die Antwort ist mal wieder herrlich diplomatisch und stößt streng wörtlich genommen weder die einen noch die anderen vor den Kopf (sagt er ja auch: er muß der Einheit dienen), und bei Bedarf kann er die eine oder andere Interpretation vorschieben. Nur daß er auf Dauer damit beide Seiten (die sich überhaupt für die Frage interessieren) vergrätzt, die nämlich beide eine klare Positionierung wünschen. Wie wollen wir eigentlich wieder missionarisch werden, wenn wir auf klare Fragen keine klaren Antworten geben können?!
DISCLAIMER: Dieses Posting ist Ausdruck meiner persönlichen Enttäuschung darüber, daß Kardinal Meisner sich aus einer klar und präzise formulierten Frage einfach „rausgewieselt“ hat. Nicht mehr und nicht weniger.
Einige Gedanken zu Norberts „Warum mußte Jesus am Kreuz sterben“-Posting:
Zunächst einmal: Der Kreuzestod Jesu ist das historische Faktum, alles andere sind Versuche, dieses auf den ersten Blick katastrophale und auf den zweiten Blick (Ostern, Auferstehung) noch umso unverständlichere Ereignis zu deuten, insbesondere auf der Basis des AT („Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.“ Lk 24,26).
Der christliche Glaube ist keine Ideologie, die krampfhaft versucht, die Realität an ihr Denken anzupassen (und wenn das nicht klappen will: umso schlimmer für die Realität), sondern vor allem Erfahrungsdeutung, Deutung von erlebtem Leben auf dem Hintergrund der Gottesbeziehung.
Ursprünglich ist die Erfahrung der Berufung und Führung auch in schwierigen Situationen durch Gott (Abraham, Isaak, Jakob, Josef) sowie die Rettung aus Ägypten (Mose). Ging es zunächst um Einzelpersonen, mit denen Gott einen Bund schloß, geht es seit Mose um das ganze Volk. Bund bedeutet: Gott wendet sich Menschen in besonderer Weise zu, stellt im Gegenzug aber „Bundesbedingungen“. Diese Bedingungn stellen keine Willkür des Allmächtigen dar, sondern sind Verhaltensregeln, die auch rational einsichtig sind und einem guten Zusammenleben dienen. Nur sind diese Regeln eben nicht gerade auf das größte Haben und Werden für den Einzelnen ausgelegt, sondern für ein gutes Leben für alle.
Die Israeliten stellten immer wieder fest (schon in der Wüste, auch und vor allem aber später und durch die Propheten): Solange wir auf Gott vertrauen, ist zwar nicht unbedingt alles immer rosig, es gibt auch so Betrüger, Diebe und Verbrecher, aber im großen und ganzen ist das Volk rechtschaffen. Je mehr es sich aber von Gott abwendet, umso mehr greifen Hochmut, Stolz und Gewalttat um sich. So mag es einigen, zeitweise sogar vielen besser zu gehen scheinen (aber auf Kosten anderer!), aufs ganze gesehen verlieren aber alle. Ganz so einfach ist es zwar nicht, der Versuch, einen unmittelbaren Tun-Ergehen-Zusammenhang zu behaupten, also daß dem, der gerecht ist vor Gott, auch nichts Schlimmes zustößt, der Frevler aber schnell an seinen Freveln zugrundegeht, ließ sich nicht auf lange Sicht durchhalten. Zu oft litten Gerechte, zu oft kamen Frevler ungeschoren davon, und pervers wurde es, als aus dem Schicksal eines Menschen auf seinen „Gerechtigkeitsstatus“ geschlossen wurde.
Im großen und ganzen aber zeigte die Erfahrung: Je mehr sich das Volk als ganzes von Gott abwandte, umso größer wurde die endgültige Katastrophe. Denn Machtmißbrauch, Unterdrückung, Hochmut, Selbstgerechtigkeit führen zu Realitätsverslust, zu faulen Kompromissen, zu Heuchelei. Gottes Bediungen sind die Bedingungen eines gelingenden Lebens und einer gerechten Gesellschaft. Sie zu mißachten trägt die Strafe im Grunde in sich selbst — weil das eine Mißachtung der (Regeln der) Schöpfung und des Schöpfers ist.
Eine solche Mißachtung wird als Sünde bezeichnet, und damit wird ein Verhalten gemeint, das eine Beziehung belastet oder gar zerstört — zwischen Menschen und Menschen ebenso wie zwischen Mensch und Gott. Die Zerstörung dieser Beziehung ist eine dem sündhaften Verhalten inhärente Folge. Wie ein Ehebruch die Beziehung zum Ehepartner zerstört, zerstört die Sünde die Beziehung zu Gott. Gott aber ist die Quelle und der Urgrund der Welt, Er hat sie erschaffen und ihr Regeln gegeben. Wer sich von der Quelle trennt, verliert einen wesentlichen Zugang zu den Regeln der Welt. Zwar sind sie als rational nachvollziehbar auch durch den menschlichen Geist erkennbar, das schützt aber nicht vor Irrtum, der dazu führt, daß selbst mit bester Absicht das Falsche getan wird. Es ist ein langsamer, schleichender Prozeß, aber er führt spiralenförmig immer weiter von Gott weg und das Böse wird immer normaler.
Um diesen Prozeß zu zerstören, bedurfte es des Sühnetodes Christi. — Nicht weil Gott rachsüchtig wäre und besänftigt werden wollte („Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie Dir geben; an Brandopfern hast Du kein Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen.“ Ps 51,18f.), sondern weil die Menschen — nicht als Einzelne, aber in der Gesamtheit — auf anderem Wege nicht erreichbar waren, wie das Schicksal Jesu zeigt.
Jesu Mission war die Wiederherstellung, die (neue) Sammlung Israels (vlg. etwa die zwölf Apostel als die neuen Stammväter). Hätten die Juden dieses Angebot als Volk angenommen, hätte es des Kreuzes nicht bedurft. Die Menschwerdung Gottes und die neue Sammlung Israels wären die entscheidenden Heilsereignisse geblieben (unter anderem deshalb das Verneigen bzw. Knien bei den Aussagen des Glaubensbekenntnisses zur Menschwerdung). Aber die Wiederherstellung hatte Bedingungen — keine Vorraussetzung wie ein besonders moralisches Verhalten, wohl aber Konsequenzen: Umkehr, Buße, Demut, eben einen zerknirschten Geist. Insbesondere bei denen, die von der bisherigen Situation profitierten, stieß das aber auf wenig Gegenliebe. Der Stolz war stärker. Daraus folgten die Ablehung (mit ihren inhärenten Konsequenzen), der Todesbeschluß usw. Wer sich ein wenig mit der conditio humana auskennt, wird wohl zustimmen: Mußte nicht alles so kommen?
Deshalb hatte Gott einen „Plan B“: Stellvertretend die Schuld der Menschen auf sich nehmen, am Kreuz den (eigentlich jedem Menschen „zustehenden“) Tod des von Gott Verfluchten sterben, anstelle der Menschen in die Hölle hinabsteigen und sie — als der ganz Unschuldige — zu sprengen und den Tod zu überwinden.
Wie gesagt: Der Kreuzestod ist historisches Faktum, alles andere sind Deutungen, die mit Hilfe von bereits Bekanntem zu erklären versuchen, was dort unableitbar Neues geschehen ist. Eine dieser Deutungen ist der Sühnetod. Und sie macht vor allem deutlich, daß mit dem Kreuzestod Jesu jeder menschliche Versuch, Schuld zu überwinden, überflüssig geworden ist und schon immer defizitär war. Indem der Gottessohn stellvertretend für uns unsere Schuld sühnt, wird deutlich, daß sich der Mensch a) nicht allein von den Folgen der Sünde befreien kann, b) aber auch nicht einfach von jeder Schuld losgesprochen ist, sondern sich immer wieder neu in Demut unter das Kreuz Christi stellen muß, um von dort die Versöhnung mit Gott zu empfangen. Zugleich macht diese Deutung aber auch nur einen, wenn auch wesentlichen, Aspekt des Kreuzesopfers deutlich und muß immer auch mit anderen Deutungen zusammengelesen werden.