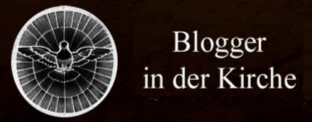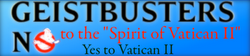Je länger ich über die Frage nach dem Ursprung der Nicknameverwendung im Internet nachgedacht habe, desto deutlicher wurde mir, wieviele verschiedene Aspekte zu dieser Frage gehören, daß es letztlich tatsächlich um die Frage geht, was das Internet eigentlich ist, und daß diejenigen, die hier klare Identität fordern, Pseudonymität als Anonymität verunglimpfen, Blogger für gefährlich halten und durch Enttarnung ruhig zu stellen versuchen, schlicht und ergreifend das Internet nicht verstanden haben. Das soll kein Vorwurf sein, denn wer damit nicht groß geworden ist, hat es mit Sicherheit schwerer, das Neue am Internet als neu zu begreifen. Vielmehr wird er versuchen, das neue Medium in sein bestehendes Wissen der existierenden Medien einzugliedern, so daß er nur das am Internet erkennen kann, was er von bestehenden Medien bereits kennt.
Aber ich will nicht vorgreifen, der Gedankengang setzt nochmal zwei Ebenen und zwei Jahrzehnte früher an, und zwar bei Theorien und Entwicklungen, die tatsächlich problematisch sind. In der Frühzeit des WWW (die nicht identisch ist mit der des Internets, sondern nur mit dem Beginn dessen massenhafter Verbreitung) gab es Vorstellungen, die aus theologischer Perspektive nur als Erlösungslehren verstanden werden können, nämlich als Erlösung vom eigenen Ich, von der eigenen Identität mit all ihren Diskrepanzen, biographischen Brüchen etc. Der Avatar im Internet hatte keine Geschichte und konnte sich daher seine Identität komplett selbst schaffen, der Nutzer sich virtuell neu schaffen. Anstatt sich der eigenen Schwäche zu stellen, war die Hoffnung, durch noch mehr „Selbermachen“ sich von dieser Schwäche zu befreien. Diese Theorien sind aus theologischer Perspektive mit Sicherheit nicht unproblematisch, um es mal vorsichtig auszudrücken. Eine Wiederentdeckung der Buße und die Anerkenntnis der eigenen Schwäche wäre zwar die unangenehmere, aber erfolgversprechendere Variante gewesen.
Nun habe ich mich damals für Metatheorien des Internets noch nicht interessiert, ich habe es einfach genutzt. Insofern ist mein Urteil aus der Rückschau auf das Scheitern dieser Hoffnungen natürlich wohlfeil, dennoch kann ich mich angesichts des ganzen Cyberpunkgenres und der starken Prägung der Hacker-, Nerds- und Geeksszene durch dieses Genre (massenkompatibel in der Matrixtrilogie verarbeitet) nicht des Eindrucks erwehren, daß schon damals diese Hoffnungen nicht von der Masse der Internetnutzer (damals eben noch die Hacker, Geeks und Nerds, der Rest war dünn gesäht) geteilt wurde. Denn Cyberpunk ist (post-)apokalyptisch und fortschrittsskeptisch. Sicherlich besteht auch ein starkes Interesse an den technischen Möglichkeiten, jedoch immer vor dem Hintergrund, daß mißbraucht werden wird, was mißbraucht werden kann. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, daß die gescheiterten Figuren, die als Helden die Cyberpunkromane bevölkern, die Hoffnung auf ein besseres Leben durch das Internet und die Trennung des Menschen von seiner körperlichen „Wetware“ stützen können. Im Gegenteil.
Und damit sind wir bei der anderen, mitunter paranoiden, aber nichtsdestoweniger realitätsrelevanten und meines Erachtens gewichtigeren Quelle für die Nutzung von Nickname-Pseudonymen im Internet, nämlich dem Schutz der Privatsphäre vor dem Datenmißbrauch durch weniger freundlich gesinnte Zeitgenossen. Daß diese Befürchtungen nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, zeigen die unzähligen Phishing-Seiten, Keylogger und Trojaner. Heute kennt man sich damit ja leidlich aus, aber immer noch gibt es immer wieder neue Tricks zum (teilweisen) Identitätsdiebstahls. Daß hier die Gefahr vor allem von wirtschaftlichen und weniger staatlichen Interessen ausgeht, ist auf dem Hintergrund des Cyberpunks im Gegensatz zur klassischen (und durchaus immer noch gegebenen) Gefahr durch den Überwachungsstaat durchaus ein spannendes Detail, denn ein wesentliches Element des Cyberpunks ist die Macht der großen Wirtschaftsunternehmen, die letztlich die Weltgeschichte lenken.
In diesem Kontext sollte vielleicht auch bedacht werden, daß im Augenblick im Internet ein Kampf zwischen Facebook und Google tobt, wer die besser verwertbaren Daten seiner Nutzer generieren kann. Wer diesen Kampf gewinnt, ist noch offen, nichtsdestoweniger geht die größte Gefahr für die eigenen privaten Daten und damit die Privatsphäre nicht vom Staat, sondern von den größten Playern in der Internetwirtschaft aus. Ohne bestreiten zu wollen, daß es wie im Fall der „site which should not be named“ auch das gegenteilige Interesse gibt, steht vermutlich in den meisten Fällen nicht die Absicht, sich vor dem eigenen Arbeitgeber, schon gar nicht der Kirche, zu schützen im Vordergrund, sondern der Schutz vor den Datenkraken des Internets.
Wenn ich als Nutzer von Blogger, Google Reader, Google-Suchmaschine, Google Maps, Google Places und Google Analytics bedenke, was Google bereits an Daten von mir hat, dann müssen die beim besten Willen nicht auch noch meinen Klarnamen wissen, der in Null-Komma-Nichts zu Adreßdaten führt, womit Google im Grunde nicht nur ein komplettes Internetnutzungsprofil von mir erstellt hätte, sondern zugleich noch mit meinen personenbezogenen Daten verknüpft hätte. Wunderbare Vorstellung. Absurd? Keineswegs: Habt ihr euch schonmal gefragt, warum Facebook in seinen AGB auf echten Namen besteht und sich vorbehält, Sockenpuppen ohne Ankündigung zu löschen…???
Wer sein Internetleben tagtäglich mit dem Login bei Facebook beginnt, hat genau dieses personenbezogene Profil an Facebook verkauft, und das ist der große Vorteil von Facebook im Kampf gegen Google (ganz davon abgesehen, daß Facebook mit dem Like-Button den genialen Schachzug getan hat, ganz offen fremde Seitenbetreiber zu ihren Erfüllungsgehilfen zu machen — ohne daß Facebook das ganze einen Cent kosten würde!). Also halten wir fest: Privatsphäre ist zumindest meiner Meinung nach der wichtigste Grund für die Nutzung von Pseudonymen und Nicknames als Vorsichtsmaßname im Internet: Wichtiger als jeder Schut gespeicherter Daten ist die Verhinderung, daß Daten überhaupt erst gespeichert werden.
(to be continued)