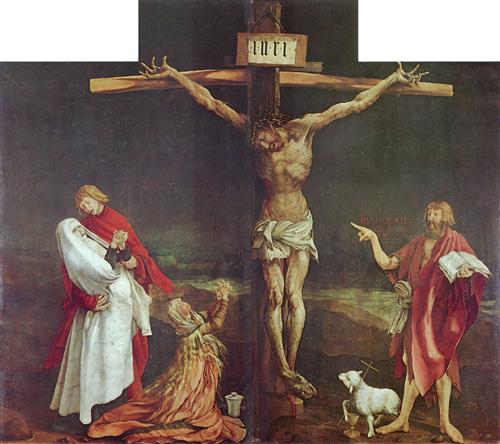Bischof Feige hält in einem Interview mit der KNA die Frauenordination für möglich und das Argumentieren mit der Tradition für unzureichend.
ad traditionem
Wenn es in der katholischen Kirche 2019 nicht mehr ausreicht, mit der Tradition zu argumentieren, dann ist Polen bereits offen. Es gibt kein legitimes theologisches Argument, das nicht aus der Tradition stammt. Das hat einfach mit den loci theologici zu tun, also den Quellen theologischer Argumente. Ohne allzusehr ins Detail gehen zu wollen, kennt die Kirche nur zwei aufeinander verwiesene Offenbarungsquellen, aus denen theologische Argumente abgeleitet werden können: Schrift und Tradition. Diese sind insofern aufeinander verwiesen als die Heilige Schrift selbst Teil der Tradition ist und die Tradition in ihrem Kern Schriftauslegung. Dabei ist die Tradition als der eine große und ununterbrochene Prozeß der Glaubensweitergabe von Generation zu Generation zu verstehen (Werbeblock: Wer zuviel Geld hat, kann sich ja mal meine Diplomarbeit über den „Kanon“ von Vinzenz von Lerin reinziehen, womit auch geklärt wäre, wo mein Pseudonym seinen Ursprung hat :-).
Aber meint Bischof Feige hier nicht etwas anderes mit Tradition, nämlich Gewohnheit? Nein! Ganz klar nein! Denn die vom kirchlichen Lehramt in Ordinatio Sacerdotalis aufgeführten Gründe gegen die Frauenordination sind nicht aus mehr oder weniger langen Gewohnheiten abgeleitet, sondern aus der Schrift, die mit Hilfe der Glaubensüberlieferung, also dem Prozeß der Tradition, ausgelegt wird.
Hier zeigt sich ein unanimis consensus patrum, ja saeculi – kein katholischer Autor kennt die Weihe von Frauen, die vielmehr als Zeichen heidnischer oder häretischer Gruppen verstanden wird, z.B. bei Gnostikern, Katharern und Waldensern. Dabei wird nicht aus Gewohnheit oder patriachalischer Misogynie argumentiert (wenngleich solche Argumente gelegentlich als Angemessenheitsgründe angeführt werden), sondern lehrmäßig – aus dem in der Schrift vorgefundenen Willen Christi heraus. Die ungebrochene Gewohnheit, dass die Kirche noch nie Frauen zur Priesterweihe zugelassen hat, kommt dann in den Argumenten von Paul VI. und Johannes Paul II. nur als äußere Bestätigung der bereits belegten inneren Überzeugung ins Spiel.
Natürlich setzt Bischof Feige auf die Zweideutigkeit des Begriffs und die – nach 50 katechesefreien Jahren erwartbare – Unkenntnis der Gläubigen über den Begriff der Tradition. Dieser Begriff ist in der landläufigen Wahrnehmung negativ besetzt und zu einem Synonym für Gewohnheit geworden. Er erwartet, daß bei den mehr oder weniger unbedarften Lesern seines Interviews all die negativen Konnotationen des Begriffs aufgerufen werden und man ihm spontan recht gibt, man brauche bessere Argumente als die bloße Gewohnheit. Und wer wollte letzteres bestreiten!
Doch ist das theologische Argument mit der Tradition eben nicht diese bloße, am besten noch unreflektierte Gewohnheit, sondern das glatte Gegenteil: Die Tradition, der Prozeß der Glaubensweitergabe, ist nach über 5.000 Jahren doch recht ausgefeilt, und nach rund 2000 Jahren christlichen Durchdenkens und Theologie in einem Maße reflektiert, daß man als heutiger Theologe, um überhaupt noch irgendwas Neues „entdecken“ zu können, sich schlicht etwas ausdenken muß (oder irgendeine nicht ganz so bekannte Häresie aus dem Reservoir von 2.000 Jahren wieder aufwärmen).
ad sacerotalem ordinationem
Papst Johannes Paul II. hat in Ordinatio Sacertdotalis (der Text ist übrigens nicht lang, kann man mal eben nebenbei lesen, außerdem sollte man den wesenlichen Verweisen, insbesonderen zu Inter Insigniores folgen, es lohnt sich!) als endgültig festgestellt, dass die Priesterweihe von Frauen unmöglich ist, weil die Kirche keine Vollmacht hat, die Sakramente über den Willen Christi hinaus auszudehnen. Man kann es so zusammenfassen:
Weder Schrift noch Tradition in ihrer Gesamtheit lassen auch nur den leisesten Anhalt erkennen, daß Christus bei der Einrichtung des Sakraments des Ordo eine Weihe von Frauen eingeschlossen hätte. Wenn Christus aber keine Frauen weihen wollte, hat die Kirche schlicht keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern.
Vielmehr ist es die beständige Lehre aller Päpste einschließlich Franziskus (Evangelium Gaudium Nr. 104), dass dieses Tor geschlossen ist. Zuletzt hatte sich der Präfekt der Glaubenskongregation erst im Mai 2018 genötigt gesehen, dies in Erinnerung zu rufen.
Alle Gegenargumente basieren auf rein konjunktivistischer Mutmaßerei: Wenn Christus heute gelebt hätte, würde er Frauen geweiht haben. Mal davon abgesehen, daß dies eine völlig uninteressante Hypothese ist – denn Christus hat nun einmal nicht heute gelebt, sondern sich entschieden, vor 2000 Jahren zu leben! –, gibt es durchaus einige Gründe, anzunehmen, daß, wenn Er Frauen als Priester gewollt hätte, Er dies ohne weiteres getan hätte.
Die Frauen im Gefolge Christi spielten eine damals geradezu skandalöse Rolle. Sie finanzierten seine Wanderpredigerschaft und waren – völlig unerhört für die damalige Zeit – mit Ihm und Seinen Jüngern unterwegs auf eben dieser Wanderschaft. Seine Beziehung zu ihnen war zum Teil so nah, daß Ihm bis heute nicht nur von Dan Brown Verhältnisse oder gar mehr mit Maria Magdalena angedichtet werden. Es wäre ein leichtes gewesen, sie auch zum Letzten Abendmahl mitzunehmen und zusammen mit dem Zwölferkreis zu Priestern zu weihen. Aber nicht einmal in den Zwölferkreis hat Er eine Frau aufgenommen, und niemanden außer dem Zwölferkreis hat Er zum Letzten Abendmahl zugelassen.
Im Gegensatz zu den Begriffen Apostel und Diakon, die an einigen Stellen der Heiligen Schrift durchaus in femininer Form auftauchen, ist dies für Presbyter (aus diesem Wort hat sich unser „Priester“ entwickelt) und Episkopoi (Bischöfe) nirgends der Fall.
Für die Diakonin hat die Liturgiewissenschaft inzwischen festgestellt, dass es sie durchaus gab, aber nicht im Sinne einer sakramentalen Weihe, sondern im reinen Wortsinn, also Helferinnen des Bischofs insbesondere bei Taufen von Frauen, die damals Ganzkörpertaufen waren.
Ähnlich wie bei Feiges o.g. Äquivokation zwischen der Tradition und den Traditionen setzt auch das „Apostolin“-Argument auf ein landläufiges Mißverständnis, die Gleichsetzung der Funktions“~ und der Amtsbezeichnung „Apostel“. Als Amtsbezeichnung bezieht sich „Apostel“ ausschließlich auf die Zwölf und Paulus, und ihr Amt wird nur von denen weitergetragen, die sie einsetzten. Die Wortbedeutung ist jedoch ähnlich wie die des Engels die Beschreibung der Tätigkeit des Bote-Seins. So werden etwa auch der heilige Bonifatius „Apostel der Deutschen“ und die heiligen Cyrill und Methodius „Slawen-Apostel“ genannt. In diesem Sinne bezeichnet auch die kirchliche Liturgie seit alters her Maria Magdalena als die Apostelin der Apostel – wohl wissend, daß dies ein Wortspiel und keine Identifikation ist.
Was mich an alledem am meisten erschreckt, ist das völlige Fehlen von belastbaren Argumenten. Bei Bischof Feige ist da nicht mehr als ein Blabla, daß man die Lehre nicht davon abhalten dürfe, sich zu ändern, wie Papst Franziskus sage (obwohl der die Unmöglichkeit der Frauenweihe ausdrücklich bestätigt hat, s.o.) und daß er sich selbst vor ein paar Jahren noch nicht hätte vorstellen können, die Möglichkeit der Frauenweihe zu denken.
Da geht es mir genau andersherum. Ich konnte mir die Möglichkeit der Frauenweihe immer vorstellen, so als rein praktische Möglichkeit, aber nie ein einziges, im letzten überzeugendes Argument dafür finden. Wie gesagt, alle Argumente dafür sind entweder untheologisch oder beziehen sich ausschließlich auf Diakoninen.
Die Argumente für die Frauenpriesterweihe sind in den letzten Jahren weder besser noch mehr geworden. Es ist vielmehr ein trotziges „jetzt erst recht“: Ich habe zwar nicht ein einziges Argument, ich will aber!!!!111111einself Kommt mir als Vater durchaus bekannt vor.
So ist das Beleidigendste an dem Text, der kürzlich auf Facebook die Runde machte, nicht etwa die Forderung nach dem Frauenpriestertum.
Am meisten stößt mir die strunzdoofe, nicht einmal die Ebene des rein Assoziativen erreichenden Logik hinter dem Text auf, die man schon geradezu böswillig nennen muß. Nur ein besonders deutliches Beispiel:
wenn eine frau
jesu sinneswandlung durch ein brotwort wirkte [Mt 15,27, Mk 7,28]
warum sollten frauen dann
bei der wandlung nicht das brotwort sprechen
Ich weiß nicht, ob dafür Triple-Facepalm oder 23 Bier überhaupt ausreichen. Ich bin ja eigentlich ganz gerne für fast jeden Schwachsinn zu haben. Aber dieser Schwachsinn da ist kein richtiger[tm] Schwachsinn. Er ist böswillig: Wohl wissend, daß es Schwachsinn ist, hat man sich hinter scheinbaren Bibelreferenzen versteckt, die man auch noch terminologisch vergewaltigen mußte, um überhaupt eine Strophe draus zu basteln.
Doch selbst, wenn ich die Terminologie noch für einen Moment beiseite lasse, besteht schlicht kein Zusammenhang zwischen den ersten und den letzten beiden Zeilen. Keiner. Überhaupt. Keiner. Nix Logik. Nicht mal falsche Logik:
aus „a“ folgt „b“
dann müsse aus „c“ auch „d“ folgen
Einziger Zusammenhang: der Terminus „Brotwort“. Als terminus technicus auf das erste der Wandlungsworte bezogen und so in der letzten Zeile verwendet.
Das vermeintliche „Brotwort“ aus der zweiten Zeile lautet hingegen (in der matthäischen Fassung):
Ja, Herr! Aber selbst die kleinen Hunde essen von den Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.
„Brotiger“ wird es nicht.
Während in den Wandlungsworten von tatsächlichem Brot die Rede ist, das Sein Leib wird, bleibt das Brot hier reine Metapher, die für den Glauben, die Gnade und das Wirken Christi steht. Was also Jesu „Sinneswandel“ verursacht, ist nicht das wirksame Wort, das aus dem bloßen Zeichen das macht, was es bezeichnet, sondern der Glaube der Frau, der sich im Bekenntnis zum Vorrang der Juden und im Vertrauen auf die überfließende Gnade und Güte ihres Gottes manifestiert:
Frau, dein Glaube ist groß. Es soll dir geschehen, wie du willst.
Aber vielleicht ist alles noch viel schlimmer. Nicht nur in nämlichen Text fehlt jeglicher Bezug auf das Wesen des Priestertums, nämlich sich als Werkzeug Christus zur Verfügung zu stellen, so daß Er durch den Geweihten wirken kann. Oder aus der anderen Perspektive formuliert: daß der Priester geweiht wird, um in persona Christi zu leiten, zu lehren und zu heiligen. Wir haben nur einen Hirten, Jesus Christus selbst. Alle anderen, die wir als Hirten bezeichnen, sind nur insofern Hirten, als sie in persona Christi handeln, also Christus durch ihr Handeln wirken lassen.
Wer als Geweihter nicht Christus wirken läßt, sondern sich in Widerspruch zur katholischen Lehre setzt, der sammelt nicht, der zerstreut!
ad titulum
Thus ends the Fifth Battle
By the treachery of men the field is lost
The night falls
And great is the triumph of evil